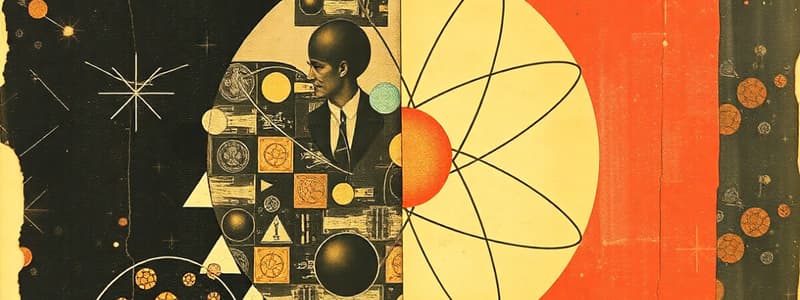Podcast
Questions and Answers
Wer formulierte den Satz von der Erhaltung der Elemente?
Wer formulierte den Satz von der Erhaltung der Elemente?
Daniel Sennert
Was besagt das Gesetz von der Erhaltung der Masse?
Was besagt das Gesetz von der Erhaltung der Masse?
- Die Masse der Edukte ist immer größer als die der Produkte.
- Die Masse der Produkte ist immer größer als die der Edukte.
- Die Summe der Masse der Edukte ist gleich der Summe der Masse der Produkte. (correct)
- Die Masse der Edukte und Produkte kann sich beliebig ändern.
Wer formulierte das Gesetz der konstanten Proportionen?
Wer formulierte das Gesetz der konstanten Proportionen?
Proust
Wasser (H₂O) ist ein Beispiel für das Gesetz der multiplen Proportionen.
Wasser (H₂O) ist ein Beispiel für das Gesetz der multiplen Proportionen.
Wie unterscheiden sich Atome verschiedener Elemente laut Dalton?
Wie unterscheiden sich Atome verschiedener Elemente laut Dalton?
Atome verschiedener Elemente verbinden sich bei chemischen Reaktionen in beliebigen Verhältnissen.
Atome verschiedener Elemente verbinden sich bei chemischen Reaktionen in beliebigen Verhältnissen.
Aus welchen Elementarteilchen sind Atome aufgebaut?
Aus welchen Elementarteilchen sind Atome aufgebaut?
Ordne die folgenden Elementarteilchen ihren Eigenschaften zu:
Ordne die folgenden Elementarteilchen ihren Eigenschaften zu:
Was ist die Massenzahl eines Atoms?
Was ist die Massenzahl eines Atoms?
Was gibt die Ordnungszahl eines Atoms an?
Was gibt die Ordnungszahl eines Atoms an?
Die Elektronenzahl ist immer gleich der Ordnungszahl, unabhängig vom Ladungszustand des Moleküls.
Die Elektronenzahl ist immer gleich der Ordnungszahl, unabhängig vom Ladungszustand des Moleküls.
Was sind Isotope?
Was sind Isotope?
Woraus bestehen Mischelemente?
Woraus bestehen Mischelemente?
Wie ist ein Atom nach dem Rosinenkuchenmodell von Thomson aufgebaut?
Wie ist ein Atom nach dem Rosinenkuchenmodell von Thomson aufgebaut?
Was war die Erwartung beim Rutherfordschen Atommodell-Experiment?
Was war die Erwartung beim Rutherfordschen Atommodell-Experiment?
Welche Annahmen treffen das Bohrsche Atommodell?
Welche Annahmen treffen das Bohrsche Atommodell?
Wie werden Orbitale im quantenmechanischen Atommodell beschrieben?
Wie werden Orbitale im quantenmechanischen Atommodell beschrieben?
Was ist die Hauptquantenzahl n?
Was ist die Hauptquantenzahl n?
Die ______ gibt die Orbitalform an.
Die ______ gibt die Orbitalform an.
Was gibt die Magnetquantenzahl m an?
Was gibt die Magnetquantenzahl m an?
Das Pauli-Prinzip besagt, dass zwei Elektronen in einem Atom in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen dürfen.
Das Pauli-Prinzip besagt, dass zwei Elektronen in einem Atom in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen dürfen.
Was besagt die Hundsche Regel?
Was besagt die Hundsche Regel?
Was passiert mit dem Atomradius innerhalb einer Gruppe im Periodensystem von oben nach unten?
Was passiert mit dem Atomradius innerhalb einer Gruppe im Periodensystem von oben nach unten?
Innerhalb einer Periode nimmt der Atomradius von links nach rechts zu.
Innerhalb einer Periode nimmt der Atomradius von links nach rechts zu.
Was ist die Ionisierungsenergie?
Was ist die Ionisierungsenergie?
Wie verändert sich der metallische Charakter innerhalb des Periodensystems?
Wie verändert sich der metallische Charakter innerhalb des Periodensystems?
Was ist die Elektronenaffinität?
Was ist die Elektronenaffinität?
Edelgase haben eine hohe Elektronegativität.
Edelgase haben eine hohe Elektronegativität.
Das elektronegativste Atom ist ______.
Das elektronegativste Atom ist ______.
Wie bestimmt die Elektronegativität der Atome die Art der Bindung?
Wie bestimmt die Elektronegativität der Atome die Art der Bindung?
Welche Art von Bindung entsteht zwischen Nichtmetallen?
Welche Art von Bindung entsteht zwischen Nichtmetallen?
Wann spricht man von einer unpolaren kovalenten Bindung?
Wann spricht man von einer unpolaren kovalenten Bindung?
Bei einer polaren kovalenten Bindung sind die Bindungselektronen gleichmäßig verteilt.
Bei einer polaren kovalenten Bindung sind die Bindungselektronen gleichmäßig verteilt.
Was ist eine Partialladung?
Was ist eine Partialladung?
Bei einer Ionenbindung, auch ______ Bindung genannt, bilden sich Salze.
Bei einer Ionenbindung, auch ______ Bindung genannt, bilden sich Salze.
Was ist ein Kation?
Was ist ein Kation?
Was beschreibt die Summenformel eines Ionenkristalls?
Was beschreibt die Summenformel eines Ionenkristalls?
Salze haben niedrige Schmelz- und Siedepunkte.
Salze haben niedrige Schmelz- und Siedepunkte.
Wie ist die Löslichkeit von Salzen?
Wie ist die Löslichkeit von Salzen?
Was versteht man unter Ionenradien?
Was versteht man unter Ionenradien?
Ordne die folgenden Koordinationszahlen (KZ) ihrer geometrischen Struktur zu:
Ordne die folgenden Koordinationszahlen (KZ) ihrer geometrischen Struktur zu:
Was passiert mit der Gitterenergie, wenn Ionen aus dem Gaszustand zu einem Ionenkristall zusammengefügt werden?
Was passiert mit der Gitterenergie, wenn Ionen aus dem Gaszustand zu einem Ionenkristall zusammengefügt werden?
Was ist die Coulomb-Energie?
Was ist die Coulomb-Energie?
Kleine Ionen führen zu einer niedrigen Gitterenergie.
Kleine Ionen führen zu einer niedrigen Gitterenergie.
Wovon hängt die Bindigkeit ab?
Wovon hängt die Bindigkeit ab?
Wovon hängt die Bindungsenergie ab?
Wovon hängt die Bindungsenergie ab?
Was ist die Valenzbindungstheorie?
Was ist die Valenzbindungstheorie?
Was ist die Molekülorbitaltheorie?
Was ist die Molekülorbitaltheorie?
Was beschreibt das VSEPR-Modell?
Was beschreibt das VSEPR-Modell?
Mehrfachbindungen benötigen weniger Raum als Einfachbindungen.
Mehrfachbindungen benötigen weniger Raum als Einfachbindungen.
Was ist die metallische Bindung?
Was ist die metallische Bindung?
Wodurch werden metallische Eigenschaften beeinflusst?
Wodurch werden metallische Eigenschaften beeinflusst?
Was ist die Wasserstoffbrückenbindung?
Was ist die Wasserstoffbrückenbindung?
Was sind Van-der-Waals-Kräfte?
Was sind Van-der-Waals-Kräfte?
Dipol-Dipol-Kräfte treten auch bei unpolaren Molekülen auf.
Dipol-Dipol-Kräfte treten auch bei unpolaren Molekülen auf.
Flashcards
Atom
Atom
Kleinste Einheit der Materie, die chemische Eigenschaften eines Elements besitzt.
Ion
Ion
Ein Atom oder Molekül mit einer elektrischen Ladung.
Anion
Anion
Negativ geladenes Ion.
Kation
Kation
Signup and view all the flashcards
Ionisierungsenergie
Ionisierungsenergie
Signup and view all the flashcards
Schmelzen
Schmelzen
Signup and view all the flashcards
Verdampfen/Sieden
Verdampfen/Sieden
Signup and view all the flashcards
Inkompressibilität
Inkompressibilität
Signup and view all the flashcards
Van-der-Waals-Kräfte
Van-der-Waals-Kräfte
Signup and view all the flashcards
Speicherlöcher
Speicherlöcher
Signup and view all the flashcards
OH-
OH-
Signup and view all the flashcards
H2O
H2O
Signup and view all the flashcards
CN-
CN-
Signup and view all the flashcards
COO-
COO-
Signup and view all the flashcards
Aktivierungsenergie
Aktivierungsenergie
Signup and view all the flashcards
Low-Spin-Komplex
Low-Spin-Komplex
Signup and view all the flashcards
High-Spin-Komplex
High-Spin-Komplex
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Atombau und Atommodelle
- Der Satz von der Erhaltung der Elemente (Daniel Sennert) besagt, dass Edukte und Produkte immer die gleichen Elemente enthalten und bei einer Reaktion keine neuen Elemente entstehen. "Nichts geht verloren, nichts entsteht."
- Das Gesetz von der Erhaltung der Masse (Lavoisier) besagt, dass bei einer chemischen Reaktion die Summe der Masse der Edukte gleich der Summe der Masse der Produkte ist. Masse(E) = Masse(P)
- Das Gesetz der konstanten Proportionen (Proust) besagt, dass eine Verbindung immer die gleichen Elemente im gleichen Massenverhältnis enthält (z.B. Wasser H₂O).
- Das Gesetz der multiplen Proportionen (Dalton) besagt, dass wenn zwei Elemente A und B mehr als eine Verbindung miteinander eingehen, die Massen von A, die sich mit einer bestimmten Masse von B verbinden, in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen.
- Die Dalton-Atomtheorie besagt, dass sich Atome verschiedener Elemente in Größe, Masse und anderen Eigenschaften unterscheiden und sich bei chemischen Reaktionen in kleinen, ganzzahligen Verhältnissen zu chemischen Verbindungen verbinden.
- Atome bestehen aus Elementarteilchen: Neutronen (neutral), Protonen (positive Ladung) und Elektronen (negative Ladung).
- Neutronen und Protonen haben ähnliche Massen (~1 u), während Elektronen eine viel kleinere Masse haben (0,00055 u).
- Neutronen und Protonen sind in Quarks unterteilt (Neutron: ddu, Proton: uud).
Das Periodensystem
- Die Massenzahl entspricht der Summe der Protonen und Neutronen (Nukleonen).
- Die Ordnungszahl entspricht der Anzahl der Protonen.
- Die Elektronenzahl ist gleich der Ordnungszahl in ungeladenen Molekülen.
- Isotope chemischer Elemente sind Nuklide mit gleicher Protonenzahl, aber unterschiedlicher Nukleonenzahl und unterschiedlicher Masse.
- Mischelemente sind Elemente, die aus verschiedenen Isotopen bestehen (z.B. H₂, Cl₂, Br₂).
- Reinelemente sind Elemente, die keine Isotope bilden (z.B. Be, F, Na).
Entwicklung der Atommodelle
- Thomson's Rosinenkuchenmodell: Ein Atom besteht aus gleichmäßig verteilter positiver Ladung, in der sich Elektronen bewegen.
- Rutherford'sches Atommodell: Ein sehr kleiner Atomkern bildet den Mittelpunkt, bestehend aus Protonen und Neutronen, die durch eine starke Kernkraft zusammengehalten werden.
- Elektronen kreisen auf Bahnen um den Kern.
- Bohr'sches Atommodell (Schalenmodell): Fester, kleiner Kern und Elektronen auf konzentrischen Elektronenbahnen um den Kern.
- Elektronen befinden sich auf verschiedenen Schalen (Energieniveaus): Je näher ein Elektron am Kern ist, desto geringer ist seine Energie.
- Übergang eines Elektrons in eine andere Schale durch Energiezufuhr (Grundzustand → angeregter Zustand), bei Zurückfallen in den Grundzustand wird Energie in Form eines Lichtquants frei.
- Das Bohr'sche Atommodell ist nur für Wasserstoffatome gültig.
- Quantenmechanisches Atommodell: Beschreibt den Aufenthaltsort eines Elektrons als dreidimensionale, stehende Welle (Orbitale), beschrieben durch Quantenzahlen.
- Die Hauptquantenzahl n ist ein Maß für die Energie und beschreibt die schalenförmige Verteilung der Elektronendichte (n = 1, 2, 3, 4, 5, ...; Schalen K, L, M, N, ...).
- Je größer n, desto mehr Energie hat ein Elektron, da es weiter vom Kern entfernt ist.
- Die Nebenquantenzahl l bestimmt die Orbitalform bzw. die "Unterschale" (l = n - 1 = 0, 1, 2, 3, ...).
- l=0: s-Orbital, l=1: p-Orbital, l=2: d-Orbital, l=3: f-Orbital.
- Die Magnetquantenzahl m beschreibt die Orientierung der Orbitale im Raum (m = -l, ..., 0, ..., +l) mit 2l+1 Orientierungsmöglichkeiten.
- Die Spinquantenzahl s beschreibt die Drehung des Elektrons (s = +½: High-Spin, s = -½: Low-Spin).
- Pauli-Prinzip: 2 Elektronen dürfen nicht in allen 4 Quantenzahlen übereinstimmen (max. 2 Elektronen pro Orbital).
- Hund'sche Regel: Elektronen verteilen sich auf gleiche Orbitale so, dass eine maximale Anzahl ungepaarter Elektronen mit parallelem Spin resultiert.
Das Periodensystem der Elemente
- Der Atomradius nimmt innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu
- Der Atomradius innerhalb einer Periode nimmt von links nach rechts ab (Grund: steigende Kernladung zieht stärker an).
- Nebengruppen: d-Orbitale schirmen die Kernladung ab.
- Die Ionisierungsenergie ist die Energie, die aufgewendet werden muss, um einem Atom das am schwächsten gebundene Elektron zu entreißen. Wie gern wird ein Elektron abgegeben?
- Die Ionisierungsenergie nimmt innerhalb einer Periode von links nach rechts zu (Grund: kleinere Atome, höhere Kernladung).
- Die Ionisierungsenergie nimmt innerhalb einer Gruppe von oben nach unten ab.
- Der Metallcharakter verändert sich entgegen der Ionisierungsenergie.
- Die Elektronenaffinität ist die umgesetzte Energie bei der Aufnahme eines Elektrons durch ein isoliertes Atom im Grundzustand.
- Wie gern wird ein Elektron aufgenommen?
- Die Elektronenaffinität nimmt innerhalb einer Periode von links nach rechts zu (am höchsten bei Fluor).
- Die Elektronenaffinität nimmt innerhalb einer Gruppe schwach zu.
- Edelgase haben eine Elektronenaffinität von Null
- Die Elektronegativität ist ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms in einer chemischen Bindung, die Bindungselektronen an sich zu ziehen (Maß für die Polarität).
- Fluor ist das elektronegativste Atom.
- Die Elektronegativität nimmt innerhalb einer Gruppe ab.
- Die Elektronegativität nimmt innerhalb einer Periode zu.
Chemische Bindungen
- Die Elektronegativität der Atome bestimmt die Art der Bindung, die sie eingehen.
- Kovalente Bindung (ΔElektronegativität ≤ 1.7)
- Bindung zwischen Nichtmetallen durch gemeinsame Elektronen.
- Unpolar-kovalent (ΔEN < 0.3): Bindungselektronen sind gleichmäßig aufgeteilt, was zu gleichmäßiger Ladungsverteilung führt.
- Polar-kovalent (0.3 < ΔEN < 1.7): Bindungselektronen sind ungleichmäßig aufgeteilt, was zu Polarisierung der Bindung führt.
- Partialladung: Teilladung duech Polarisierung der Bindung.
- Formalladung: z.B. NH₄⁺.
- Koordinative/dative Bindung: Rest der Bindung von A Bindungspartner.
- Ionenbindung = heteropolare Bindung; Metall + Nichtmetall → Salz.
- Positives Ion: Kation
- Negatives Ion: Anion
- Die Summenformel beschreibt die allgemeine Zusammensetzung des Ionenkristalls, nicht eines einzelnen Moleküls.
- Das Bestreben der Atome: Edelgaskonfiguration.
Eigenschaften der Salze, Ionenradien & Kristallstruktur
- Allgemeine Eigenschaften der Salze:
- Hohe Schmelz- und Siedepunkte
- Harte, aber spröde Stoffe
- Hohe Löslichkeit in polaren Lösungsmitteln (H₂O)
- Salze leiten in Schmelze elektrischen Strom (Leiter 2. Ordnung)
- Ionenradien & Kristallstruktur
- Näherungsweise Betrachtung als starre Kugeln, gilt nur bei annähernd konstanten Radius des Ions, el.h. gleiche Koordinationszahl (KZ).
- Koordinationszahl: Zahl der nächsten Nachbarionen um ein Ion (z.B. NaCl, KZ=6).
- Regeln für Ionenradien:
- Kationen sind kleiner als Anionen (Ausnahme: K⁺, Rb⁺, Cs⁺, NH₄⁺, Ba²⁺ sind größer als das kleinste Anion I⁻).
- Innerhalb einer Gruppe nimmt der Ionenradius zu.
- Bei isoelektrischen Ionen (gleiche Elektronenkonfiguration) nimmt der Ionenradius mit zunehmender Ordnungszahl ab (O²⁻ > F⁻ > Na⁺ > Mg²⁺ > Al³⁺).
- Bei Elementen mit mehreren positiven Ionen nimmt der Radius mit zunehmender Ladung ab (Fe²⁺ > Fe³⁺).
- Kristallstrukturen:
- KZ = 2: Linear
- KZ = 3: Gleichseitiges Dreieck
- KZ = 4: Tetraeder
- KZ = 6: Oktaeder
- KZ = 8: Würfel
- KZ = 12: Kuboktaeder
- Radienquotientenregel: (Größenverhältnis Kation/Anion) beeinflusst die Gitterstruktur RKation/RAnion > 0,73 → KZ = 8, Würfel RKation/RAnion 0,41-0,73 → KZ = 6, Oktaeder RKation/RAnion 0,22-0,41 → KZ = 4, Tetraeder
Gitterenergie, Bindungsenergie
- Gitterenergie (Ug): Freigesetzte Energie, wenn Ionen aus dem Gaszustand zu einem Ionenkristall zusammengefügt werden (Ug = Ec + ER). Ec: Coulomb-Energie – Anziehung der Ionen. ER: Abstoßungsenergie – Abstoßung der Elektronenhüllen bei Annäherung.
- Schlussfolgerungen aus der Gitterenergie:
- Kleine Ionen → hohe Gitterenergie
- Hohe Ionenladung → hohe Gitterenergie (MgO ist größer als LiCl)
- Zunahme der Gitterenergie beeinflusst die physikalischen Eigenschaften:
- Höherer Schmelz- und Siedepunkt
- Härter
- Kleinere Kompressibilität
- Salzauflösung: Gitterenergie muss überwunden werden.
- Atombindung = kovalente Bindung (Nichtmetalle; Ziel: Edelgaskonfiguration).
- Bei höheren Perioden 18-VE-Regel, s-p-d-Orbitale beteiligt.
- Bindigkeit: Anzahl der Bindungen, die ein Atom ausbilden kann.
- Bindungslänge: Abstand zwischen Atomkernen, abhängig von Atomgröße (F-F < Cl-Cl < Br-Br) und Anzahl der Bindungen (Abnahme mit Anzahl).
- Bindungsenergie: Energie zum Spalten einer Bindung, abhängig von Art und Polarität.
- Valenzbindungstheorie (VB-Theorie): Bindungselektronen den Atomen zugeordnet, lokalisierbare Bindungen, Individualität der Atome & Moleküle bleibt erhalten, nur Valenzelektronen haben Bindungsfunktion, σ-Bindungen. BO: ½ (bindende e- - antibindende e-).
- Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie): Molekülorbitale aus Atomorbitalen, delokalisiertes Elektronensystem, Bildung energetisch ähnlicher Orbitale, n Atomorbitale ➔ n Molekülorbitale, e-Verteilung über Pauli-Prinzip und Hund'sche Regel.
Das VSEPR-Modell
- Betrachtet Molekülgestalt, Elektronenpaarabstoßungsmodell.
- Moleküle Typ ABₙ: Elektronenpaare mit möglichst großem Abstand anordnen.
- Moleküle Typ ABₙEₘ : Freie Elektronenpaare beanspruchen mehr Raum, kleinerer Bindungswinkel.
- Elektronegativere Substituenten: ziehen bindende Elektronenpaare an, weniger Raumbedarf.
- Mehrfachbindungen: mehr Raum als Einfachbindungen, kleinerer Bindungswinkel.
- Metallbindung 4/5 aller Elemente, inkl. Nebengruppen, Lanthanoiden, Actinoiden.
- Metalle: Halbleiter: B, Si, Ge, As, Sb, Se, Te. Metallischer Charakter im PSE nimmt zu.
- Niedrige Ionisierungsenergie ➔ bilden leicht Ionen.
- Metallische Eigenschaften bleiben im flüssigen Zustand erhalten.
- Metall-Kristall: positive Ionen, abgegebene e⁻ als Elektronengas im kompletten Kristall verteilt.
- Zusammenhalt durch Elektronengas.
- Betrachtung der Gesamtorbitale (MOs) als Energiebänder - Überlappung von 2s- & 2p-Band ➔ elektrisch leitend. - nicht leitend bei keiner Überlappung.
- Halbleiter bei Berührung (z. B. geringe Lücke).
Wasserstoffbrückenbindung, Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol-Kräfte
- Wasserstoffbrückenbindung: Intermolekulare Anziehung zwischen H-Atom eines Moleküls und freiem Elektronenpaar eines anderen Moleküls (Bedingung: H-Atom mit rel. hoher Partialladung δ⁺, Elektronenpaar von elektronegativen Elementen).
- Van-der-Waals-Kräfte (=London-Kräfte/Dispersionskräfte): Intermolekulare Anziehungskräfte, die Moleküle in Flüssigkeiten und Feststoffen zusammenhalten (nur bei unpolaren Molekülen/kein Dipolmoment).
- Dipol-Dipol-Kräfte: Wechselwirkungen zwischen polaren Molekülen (Dipolmoment) basiert auf Abziehung unterschiedlicher geladener Pole.
Chemisches Gleichgewicht.
- Kriterien: Gleichgewichtszustand: Gesamtreaktion erscheint ruhend, aber: Konzentrationen aller beteiligten Substanzen in GGW bleibt konstant, dynamisches Gleichgewicht.
- Voraussetzung Umkehrbarkeit/Reversibilität (aA + eE ⇆ xX + zZ).
- Massenwirkungsgesetz (MWG): Berechnung der Gleichgewichtskonstante K.
- K = ([X]^x [Z]^z) / ([A]^a [E]^e)
- K ist temperaturabhängig und unabhängig von Druck, Stoffmenge und Katalysator.
- Großes K: GGW auf Produktseite.
- Kleines K: GGW auf Eduktseite.
- Sehr kleine K-Werte ➔ pK-Wert wird eingeführt (pK = -log K, K = 10⁻ᵖᴷ), negatives pK: GGW auf Produktseite, positives pK: GGW auf Eduktseite.
- K = ([X]^x [Z]^z) / ([A]^a [E]^e)
- Im GGW: Reaktionsquotient Q = K, vor GGW-Einstellung gilt: Q < K Reaktion verläuft von links nach rechts ablaufend, Q > K Reaktion verläuft von rechts nach links ablaufend, MWG gilt auch für mehrstufige, reversible Reaktionen: K = K₁ * K₂.
- Prinzip von Le Chatelier: Reaktion weicht Reaktion weichen Zwängen aus, indem sich die Lage des GGW verschiebt.
Einflussstoffe auf das chemische Gleichgewicht
- Konzentrationsänderung: E-Zugabe ↓, P-Wegnahme ↑, P-Zugabe ↓, E-Wegnahme ↑
- C(H₂O)-Änderung in verdünnter Lösung: keine Auswirkung, da in K berücksichtigt.
- Temperaturänderung Exotherme Reaktion(E wird frei): E-Zugabe ⇄ Eduktseite, E-Wegnahme ⇄ Produktseite
- Endotherme Reaktion (E wird aufgenommen): E-Zugabe ⇄ Produktseite, E-Wegnahme ⇄ Eduktseite
- Druckänderung: GGW verschiebt sich auf Seite mit weniger (Gas) Teilchen → Druck erhöhen : Seite mit wenig Edukten und wenig Produkten begünstigt
- Einfluss von Katalysatoren: GGW-Lage nicht verschoben, wirkt gleichermaßen auf Hin- und Rückreaktion, aber schnellere GGW-Einstellung.
- Löslichkeitsprodukt L (Kc): Viele Stoffe haben mind. geringfügige Wasserlöslichkeit ⇄ Gleichgewicht zwischen gelöster und ungelöster Substanz, gesättigte Lsg: VAuflösung = VAusscheidung.
Säuren und Basen
- Säure/Base-Theorien
- Arrhenius-Theorie: Erhöhen in wässrigen Lösungen Säuren die Protonenkonzentration(H+) und Basen die Hydroxidionenkonzentration(OH-). 𝐻₃𝑂⁺ ⇆2𝐻₂𝑂 →Nie freie H+ in Wasser →Je stärker eine Dissoziation mit desto stärker liegt der Gleichgewicht aus einer Säure oder Base vor. Z.B.:. HCL, HCIO4, HNO3. NAOH, KOH →auf OH-produzierende Basen reduziert (z.B NH3 nicht Erfasst) →Nur für H2O als Lösungsmittel gültig. Bronsted - Lowery →Saeure = Protonendonatoren (stark: hoher Abgabetrend) →Basen = Protonen akzepteren (stark: hoher Aufnahmetrend). GGW-Lage bestimmt Staerke von Saeure/Base → Konjugiertes Saerbase - Paar ⇄ Dissoziiertes Saeurerest - Anion kann als Base reagieren. Z.B
𝐻₂O +NH₃ ⇄ NH₄¹ +OH- + Starke Saeure/Base hat immer schache Korrepondierende Base Saeure → Ampothere Substanzen je nach loesungsmittel Saeure/Base Funktione. v Stoffe mittleren Dissoziations sufen z.B hso4 etc →Nivellierender Effekt: Eine geloeste Saeure k. Nicht staeker wirken also die zum loesungsmitel conijutite sauer: → Gleches fuer Basen Lewis Theorie : Saeuren ⇄ Elecktronnen paar Akzeptoren Basen
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.